«Wir brauchen ein Müttergeld»

Interview — Sarah Pfäffli
Bilder — Ulrike Meutzner*
Dieser Artikel erschien zuerst im Juni 2020.
Heute sollte es jungen Eltern eigentlich besser gehen als je zuvor. Wir haben die Wahlfreiheit bei den Pensen, es gibt genug Kitaplätze, unser Lebensstandard ist hoch. Doch diese vermeintlichen Wahrheiten geraten schnell einmal ins Wanken, wenn man mit Sibylle Stillhart diskutiert. Die freischaffende Autorin ist Mutter dreier Kinder und hat zwei Bücher geschrieben, die das vorherrschende Weltbild infrage stellen: «Müde Mütter – fitte Väter» (2015) und vergangenes Jahr den schmalen, aber augenöffnenden Band «Schluss mit Gratis! Frauen zwischen Lohn und Familie». In beiden zeigt sie von einem persönlichen Standpunkt ausgehend auf, warum viele Eltern und insbesondere Mütter so müde sind vom Versuch, Arbeit und Kinderbetreuung zu vereinbaren. Und dass sie nicht selber daran schuld sind, wenn sie es nicht schaffen. Sibylle Stillhart lebt in der Berner Altstadt und hat drei Kinder. Ihr Mann arbeitet als Journalist, wie auch Sibylle vor der Geburt der Kinder.
Zum Jahrestag des Frauenstreiks vom 14. Juni haben wir mit ihr darüber gesprochen, wo wir in der Schweiz stehen bei der Vereinbarkeit.
Sibylle Stillhart, in der Schweiz reduzieren die meisten Frauen ihr Arbeitspensum, wenn sie ein Kind bekommen. Auch immer mehr Männer reduzieren. Wir sind doch auf einem guten Weg in Sachen Vereinbarkeit, nicht?
Zunächst einmal möchte ich bei den Männern einhaken: Da gibt es keine Zunahme. Schon vor 12 Jahren, als ich mein erstes Kind bekommen habe, hat man gesagt, die modernen Väter würden ihr Pensum reduzieren. Doch nach wie vor arbeiten rund neun von zehn Vätern Vollzeit. Und wenn Väter reduzieren, sind es 10 bis maximal 20 Prozent.
Heute haben wir aber doch die Wahlfreiheit. Die Frauen könnten ja auch mehr arbeiten, wenn sie wollten!
Nein. Es ist eben kein freier Entscheid! Es wird uns suggeriert, wir könnten uns frei entscheiden. Aber das einzig wirklich breit akzeptierte Modell für Frauen ist in unserer Gesellschaft: Kinderhaben und ein 40- bis 60-Prozent-Pensum daneben. Das ist die politisch und wirtschaftlich geprägte Norm, der wir uns unterzuordnen haben.

«Es wird uns suggeriert, wir könnten uns frei entscheiden. Aber das einzig wirklich breit akzeptierte Modell für Frauen ist in unserer Gesellschaft: Kinderhaben und ein 40- bis 60-Prozent-Pensum daneben.»
Inwiefern?
Einerseits verdienen die Männer mehr, also ergibt es rein wirtschaftlich oft keinen Sinn, wenn die Frau mehr arbeitet. Zudem werden Mütter, die von dieser Norm abweichen, bestraft: Wer mehr arbeitet, wird als «schlechte Mutter» gebrandmarkt und finanziell bestraft, weil die Kinderbetreuung dermassen teuer ist. Wer hingegen ganz aufhört mit der Erwerbsarbeit, wird sofort in die ambitionslose SVP-Hausmutter-Ecke gestellt. Es gibt keine echte Wahlfreiheit.
Zum Finanziellen: Ich habe mehr verdient als mein Mann vor der Geburt unseres ersten Kindes.
Ich auch! Aber danach hat er als Vater den ersten Karrieresprung gemacht, den zweiten und dann den dritten.
Es ist halt gar nicht möglich, Karriere zu machen mit 60 Prozent.
Doch. Wenn ich sehe, was ich vorher in 100 Prozent geleistet habe, würde ich sagen, dass das problemlos auch in 40 oder 60 Prozent möglich gewesen wäre. Mit diesem Irrglauben will man die Menschen in hohen Pensen anbinden. Dass sich niemand gegen dieses Arbeits-Diktat wehrt, erstaunt mich immer wieder. Offenbar ist für viele ein achteinhalbstündiger Bürotag «normal». Die meisten scheinen sich in diesen Strukturen eingerichtet zu haben, so dass sie sich einigermassen wohl fühlen.
Erwerbsarbeit ist ja nicht per Definition etwas Mühseliges. Viele Menschen arbeiten hoffentlich einfach gern. Ich zum Beispiel!
Ich zitiere hier gerne die in Bern lebende Philosophin Carola Meier-Seethaler, die ich für mein Buch interviewt habe. Sie sagt: «Wenn gute Arbeit als sinnvolle Tätigkeit verstanden wird, möchte sich wohl niemand davon emanzipieren. Belastend ist Arbeit dann, wenn man einer Erwerbsarbeit nachgehen muss, die einem sinnlos erscheint oder die schädlich ist für Menschen und Umwelt. Belastend ist aber auch der Stress durch Zeitdruck, das heisst, wenn immer effizientere Leistung in kürzerer Zeit erbracht werden muss. Die härteren Arbeitsbedingungen gelten heute auch in reichen Ländern, weil sich alle im globalen Wettbewerb befinden. Dieser Wettbewerb ist einer der Grundpfeiler der neoliberalen Wirtschaftstheorie.»
Überall suchen Firmen händeringend nach Frauen, die Führungspositionen übernehmen. Warum wollen viele von uns Frauen denn nicht?
Weil viele Frauen die männlich geprägten, oft sehr hierarchischen Bedingungen nicht erfüllen können. Weil die Strukturen für sie nicht funktionieren. Oft sind die Arbeitszeiten das Problem. Das liesse sich ändern, man könnte den Menschen anbieten, freier zu arbeiten, zu den Zeiten, die für sie passen. Und der Präsenz- und Überzeit-Kult muss verschwinden. Wer immer am längsten im Büro sitzt, ist nicht besser, sondern ineffizient. Unsere Organisation ist nicht gottgegeben, wir könnten unsere Arbeit auch anders organisieren! Dass die Frauen «halt nicht wollen», ist eine Ausrede der Firmen und Institutionen. Tatsache ist: Mütter können nicht zu diesen Bedingungen.
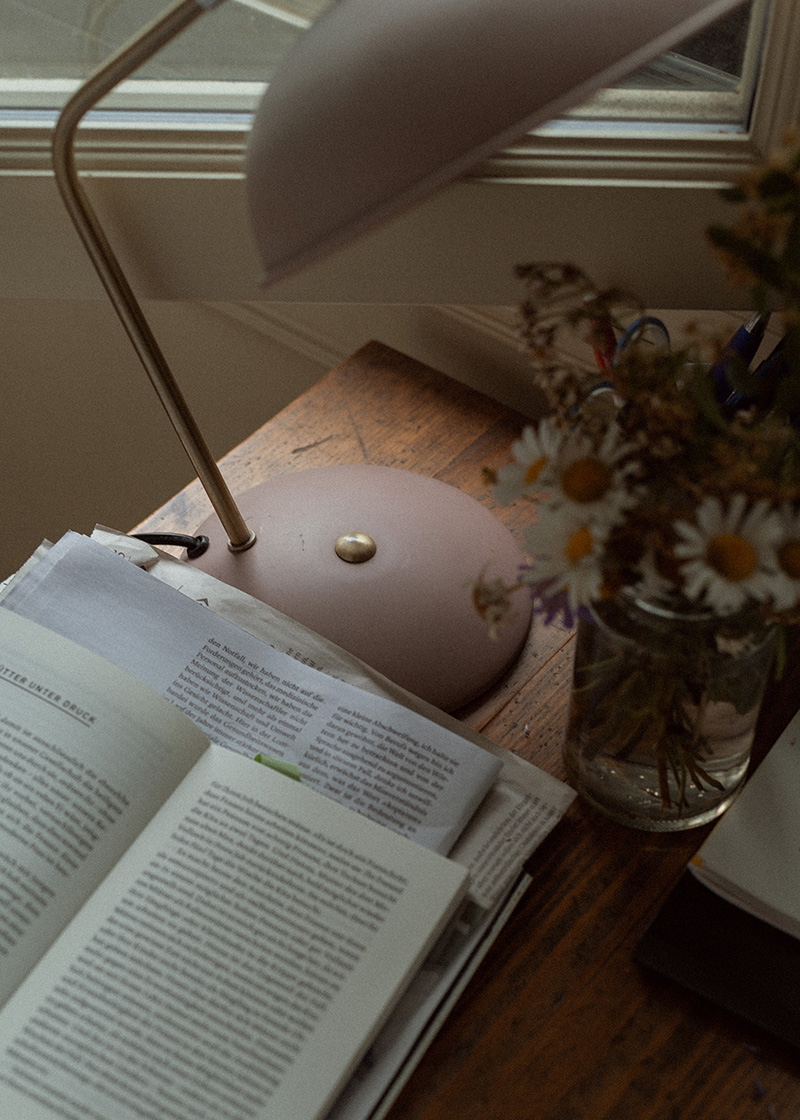
«Dass die Frauen ‹halt nicht wollen›, ist eine Ausrede der Firmen und Institutionen. Tatsache ist: Mütter können nicht zu diesen Bedingungen.»
Kinder und Teilzeitjob: Das ist der Inbegriff der Vereinbarkeit. Wer hat das so definiert?
«Vereinbarkeit von Familie und Beruf» ist ein Konstrukt; was damit gemeint ist, diktieren uns heute die Arbeitgeber. Dabei war und ist es ein langgehegter Traum von vielen Frauen Erwerbstätigkeit, Hausarbeit und Kinderbetreuung mit den Vätern zu teilen. In den 1970- und 80er-Jahren gingen die Frauen davon aus, dass diese Arbeit geteilt werden müsste mit den Männern, und zwar 50/50. Da gab es ganz wenige Eltern, die das tatsächlich auch machten. Aber die Wirtschaft war nie interessiert daran, dass die Männer Teilzeit arbeiten. Man entdeckte aber die neuerdings gut ausgebildeten Frauen als billige Arbeitskräfte und begann deshalb, die Kitas zu forcieren. Nicht als emanzipatorische Massnahme, sondern als knallharte Wirtschaftsförderung. Heute wird uns das als Wahlfreiheit verkauft. Aber Tatsache ist, dass die Frauen die Erwerbsarbeit zusätzlich zur Kinderbetreuung und Hausarbeit aufnahmen. Die Männer übernahmen nicht mehr davon.
Vereinbarkeit ist also ein Begriff der Arbeitgeber?
Ja, und sie haben ihn zur Farce gemacht. Es waren Männer, die diesen Begriff in seiner heutigen Definition prägten. Aber das ist nicht die Vereinbarkeit, wie wir Frauen sie uns einst vorgestellt haben.
Auch ich bin ihm voll auf dem Leim gekrochen. Ich habe «Lean In» von Sheryl Sandberg gelesen und war immer der Meinung, es sei eben erstrebenswert, alles gleichzeitig zu machen. Und ich dachte, man muss sich halt den richtigen Partner suchen, der das unterstützt und mitanpackt.
Das ist auch klassisch. Die Frauen müssen sich für alles rechtfertigen und die Verantwortung übernehmen, zuerst bis 30 Ausbildungen machen, dann den richtigen Job wählen und bitteschön «Karriere» machen, die richtige Anzahl Kinder haben und dann auch ja den richtigen Mann heiraten. Und wenn sie «den falschen Mann» geheiratet haben, weil der sein 100-Prozent-Pensum nicht reduziert und daheim nur «hilft», wenn sie ihm genaue Anweisungen gibt, sind sie halt auch noch selber schuld. Nein!
Die Männer müssen mehr übernehmen?
Ja, und sich selber fragen, wo sie mehr Verantwortung übernehmen sollen. Aber auch Väter stehen heute unter Druck. Ihre Löhne sind keine Ernährerlöhne mehr, und der neue Begriff des ‹modernen Vaters› ist nichts anderes, als das gleiche Konstrukt der Vereinbarkeit auf die Männer übertragen.
Wenn eine Familie glücklich ist mit dem 80/60-Prozent-Modell, ist dagegen doch nichts einzuwenden, oder?
Das Problem ist: Wenn Frauen reduzieren, haben sie aufgrund des tieferen Lohnes niedrigere Pensionskassenleistungen, obschon sie mit der Kinderbetreuung und Hausarbeit mehr arbeiten als je zuvor. Frauen verdienen 100 Milliarden Franken weniger als Männer – pro Jahr. Obwohl sie gleich viel arbeiten wie Männer. In der Schweiz wird das Kinderaufziehen quasi als Hobby betrachtet. Und Hausarbeit ist praktisch gar nicht existent. Ein Kind unter sechs Jahren bedeutet einen Aufwand von 58 Stunden pro Woche. Das wird überhaupt nicht als Arbeit berücksichtigt.

«In der Schweiz wird Kinderhaben quasi als Hobby betrachtet.»
Kindererziehen und Haushalten ist halt keine Erwerbsarbeit und hat deshalb keinen wirtschaftlichen Wert.
Und da liegt das grosse Problem. Wie konnte es kommen, dass wir die Erwerbsarbeit so blind als einzig Wahres sehen? Sie ist für uns unkritisierbar geworden. Die Wertung ist völlig verkehrt! Wir ordnen uns der Erwerbsarbeit völlig unter. Ich frage: Muss ein Bürotag wirklich 8 Stunden und 24 Minuten dauern, wenn man doch sieht, dass es in Schweden Firmen gibt, die mit einem 6-Stunden-Arbeitstag erfolgreich sind? Der britische Ökonom John Maynard Keynes hat in den 1930er-Jahren darüber gesprochen, dass wir dank der neu erfundenen Maschinen zu einer 15-Stunden-Woche kommen könnten. Was bringt die Automatisierung und Digitalisierung, wenn die Arbeit für uns nur zunimmt? Warum arbeiten wir in der unglaublich reichen Schweiz so viel, mindestens 42 Stunden pro Woche?
Man kann es auch gerade umgekehrt sehen: Wir sind eben so reich, weil wir so viel arbeiten!
Das ist ein Trugschluss. Schauen Sie mal die anderen Industrieländer an, die deutlich weniger arbeiten, Schweden beispielsweise oder Frankreich mit gerade mal 35 Stunden in der Woche: Vom Wohlstandsniveau aus betrachtet geht es allen Industrieländern etwa gleich. Es ist eine Frage des politischen Willens. Auch, dass der Mutterschaftsurlaub in der Schweiz nur 14 Wochen dauert, ist ein Skandal. Die Frauen brauchen mindestens ein Jahr nach einer Geburt. Der Mutterschaftsurlaub wird aus der Erwerbsersatzordnung bezahlt. In der Schweiz muss jeder Mann für 35 Wochen in den Militärdienst, die ihm aus der Erwerbsersatzordnung vergütet werden. Für die Geburt eines Kindes hat diese Kasse lediglich Geld für 14 Wochen. Wo liegt da die Logik? – Das Geld wäre da. Es stellt sich nur dir Frage, wie man es einsetzen will. Wie behandelt man in einem Land Frauen und Kinder? Das sieht man auch an der Länge des Mutterschaftsurlaubs.

«Dass der Mutterschaftsurlaub in der Schweiz nur 14 Wochen dauert, ist ein Skandal. Die Frauen brauchen mindestens ein Jahr nach einer Geburt.»
Und wieder die klassische Frage: Wer soll denn das bezahlen? Wenn jemand einfach ein Jahr ausfällt?
«Ausfallen»! Hören Sie, wie schon unsere Wortwahl unbewusst von der absoluten Dominanz der Konzerne geprägt ist! Wer ein Kind zur Welt bringt und ein Jahr lang ernährt und pflegt, fällt doch für die Gesellschaft nicht aus, im Gegenteil, sie macht die wichtigste Arbeit, die es überhaupt gibt! In Schweden können Eltern während 480 Tagen Elterngeld beziehen; 60 Tage davon sind ausschliesslich für Väter reserviert. Es ist eine reine Frage des politischen Willens. Wie wollen wir unser Steuergeld einsetzen? Jedes Jahr fliessen Milliarden in die Armee, in den Strassenverkehr, in die Wirtschaftsförderung, zu Winzern und Landwirten, es fallen Hunderte Millionen weg, weil Grossunternehmen Steuererleichterungen erhalten. Für Kinderbetreuung wird derweil auf Bundesebene höchstens eine Anschubfinanzierung geleistet. Über Frauen muss man gar nicht reden, die sind ja verheiratet und sollen von den Männern abhängig bleiben. Das ist auch politisch gewollt so.
Kinderbetreuung sei halt Kantonssache, der Bund darf da gar nicht reinreden.
Das ist ein Argument, das Opportunisten gerade dort benutzen, wo es ihnen passt. Anderswo ist es ihnen dann egal. Ich wiederhole mich: Es ist abermals eine Frage des politischen Willens. Meiner Meinung nach brauchen wir ganz klar Bundesgeld für Kitas, damit die Angestellten dort einen guten Lohn erhalten. Und wir brauchen einen vernünftigen Mutterschaftsurlaub.
Das Problem beim Mutterschaftsurlaub ist, dass er die bestehende Rollenverteilung zementiert. Einerseits gehen die Arbeitgeber seinetwegen ein Risiko ein, wenn sie eine Frau um die 30 herum einstellen – bei einem Mann müssen sie sich diesbezüglich keinerlei Gedanken machen. Andererseits wird die Frau daheim automatisch zum «Chef Baby», weil sie so lange allein mit dem Kind daheim bleibt und der Vater nach einem Tag wieder arbeiten muss. Das hat auch einen ungünstigen Einfluss auf die Rollenverteilung in der Familie. Wäre eine Elternzeit die Lösung?
Auf jeden Fall. Und das wäre ja auch problemlos möglich, schliesslich ist es auch kein Thema, wenn Männer wegen des Militärdiensts mal schnell zwei Monate fehlen am Arbeitsplatz. Wenn wir alle weniger arbeiten würden, würde es uns allen besser gehen.

«Eine Elternzeit wäre problemlos möglich. Schliesslich ist es auch kein Thema, wenn Männer wegen des Militärdiensts mal schnell zwei Monate fehlen am Arbeitsplatz.»
Aber die Leute wollen das gar nicht. Wir stimmten ja auch gegen längere Ferien oder kürzere Arbeitszeiten.
Weil die Arbeitgeber es nicht wollen. Die Wirtschaft, gerade die Konzerne, haben eine enorme Macht in der Schweiz. Immer wenn es eine Abstimmung gibt in der Schweiz, die die Gewinne der Grosskonzerne auch nur minim schmälern könnte, fahren die Konzerne mit einer unglaublichen Finanzkraft eine riesige Kampagne auf. Die funktionieren dann immer sehr gut mit einer krassen Angstmacherei. Das Paradeargument dabei: gefährdet Arbeitsplätze und unseren Wohlstand! Wir glauben das – und stimmen regelmässig gegen unsere ureigenen Interessen. Wir werden da krass manipuliert.
Aber es hat doch schon etwas: Wir können uns diese Diskussionen überhaupt erst leisten, weil es uns so gut geht – dank unserer florierenden Wirtschaft. Nicht?
Es stimmt ja nicht, dass wir immer reicher werden. Das gilt für ein paar wenige. Aber die meisten von uns werden überhaupt nicht reicher. Noch bei unseren Eltern reichte ein Vollzeiteinkommen aus, um sich den Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen. Heute ist es keine Frage des Willens, ob Mütter arbeiten gehen, sondern sie müssen ganz einfach. Kaum eine Familie kommt mehr mit einem Einkommen alleine durch.
Weil unsere Ansprüche gestiegen sind.
Falsch. Wer leistet sich schon noch eine Ferienwohnung, ein eigenes Haus, ein Auto – von einem Einkommen? Das ist heute für den Mittelstand undenkbar. Wenn wir so wohlhabend sind: Warum herrschen in unseren Kitas so fatale Zustände? In einem reichen Land wie der Schweiz würde man Gruppen von 3 Kindern pro Betreuungsperson erwarten und Schulklassen von allerhöchstens 20 Kindern. In der Realität sind es 10 Kinder auf eine ausgebildete Fachkraft, vielleicht noch eine Praktikantin und ein Lehrling. In der Klasse meines Sohnes sind im neuen Schuljahr 28 Kinder. Als ich ein Kind war, feierte man das als Erfolg, dass es keine Klassen mehr mit mehr als 20 Kindern gab. Es wird uns immer wieder gesagt, dass es uns so gut gehe und wir so froh sein können um all die Arbeitsplätze. Die Wahrheit ist, dass die Konzerne anteilsmässig immer weniger Steuern zahlen und dieses Geld fehlt – in der Bildung, in der Gesundheit, in sozialen Einrichtungen. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer, und der Mittelstand blutet aus.
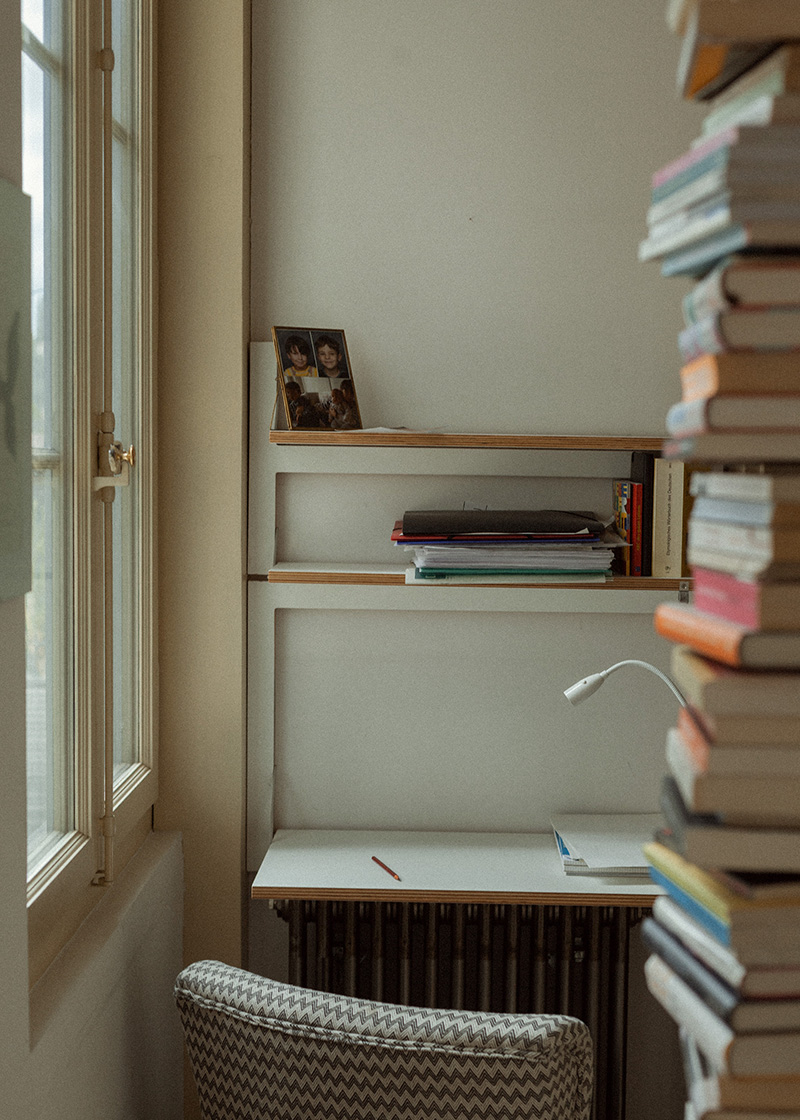
«Noch bei unseren Eltern reichte ein Vollzeiteinkommen aus, um sich den Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen. Heute ist es keine Frage des Willens, ob Mütter arbeiten gehen, sondern sie müssen ganz einfach.»
In solchen Diskussionen fällt häufig das Argument: Kinderhaben ist Privatsache.
Das ist in der Schweiz wirklich tief, tief, tief verankert. Dieser Glaube entspringt der bürgerlichen Ideologie, die der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau begründet hat. Er hatte sich gegen das Ammenwesen gewandt, bei dem der Adel seine Kinder gleich nach der Geburt für ein Jahr an arme Ammen abgab. Diese Mode hatte sich auch im Bürgertum und sogar bei unteren Schichten durchgesetzt, die in die Fabrik mussten um zu arbeiten. Die Kinder wurden dabei in miserable Zustände übergeben, die Hälfte der Kinder überlebte das erste Lebensjahr nicht. Rousseau kritisierte diese Praxis, ein ehrbarer Gedanke – nur leider begründete er damit auch aus männlicher Sicht den Mutterkult, wie wir ihn heute kennen. Die tonangebende Schicht des Bürgertums führte darauf aufbauend die Arbeitsteilung ein: Der Mann ging auswärts das Geld verdienen, die Frau kümmerte sich um Kinder und Daheim und wurde vom Geldfluss abgekoppelt. Davor hatte es diese Trennung nicht gegeben, die ganze Gemeinschaft kümmerte sich etwa um Hof, Arbeit und Kinder, auch Frauen verdienten Geld. Das Argument «Kinderhaben ist Privatsache» ist also nicht einfach absolut, sondern eine bürgerliche Erfindung. Und vor allem eine Männervorstellung. Aber leider begegnet es mir auch sehr häufig.
Was entgegnen Sie darauf?
Ich sage: Dann hätten Sie auch nicht zur Schule gehen dürfen. Die Schule ist ja auch ein Gemeinschaftswerk für alle Familien. Wir zahlen Steuern nach dem Solidaritätsprinzip. Ich zahle für die Autobahn, auch wenn ich kein Auto besitze.
Wenn das System das Problem ist: Was ist denn die Lösung? Wie sähe die ideale Welt aus?
Wir müssen uns fragen: Was ist wichtig? Meine Antwort lautet: die Menschen. Die Menschen müssen ins Zentrum unserer Gesellschaft gestellt werden. In diesem Weltbild sind alle Berufe wichtig, die mit Menschen zu tun haben, Pflege, Kinderbetreuung, und so weiter. Und diese müssen deshalb auch sehr gut bezahlt werden. Die Wirtschaft muss so organisiert werden, dass sie dem Gemeinwohl dient, nicht umgekehrt. Wer destruktive Dinge herstellt, Zigaretten, Pestizide oder Waffen beispielsweise, muss sehr hoch besteuert werden.
Das ist utopisch. Was wären realistische Ziele, erste Schritte dahin?
Ein Müttergeld. Sobald eine Frau Mutter wird, sollte sie ein monatliches Gehalt bekommen. Wir brauchen zudem Gratiskitas. Und bezahlbare Familienwohnungen.

«Im Kapitalismus ist es so: Was nichts kostet, ist nichts wert. Ich will deshalb kein Elterngeld. Ich will, dass die Frauen das Geld bekommen.»
Das Gegenargument würde lauten: Ein Müttergeld, damit sich die Frauen selber verwirklichen können im Töpferkurs?
Mütter haben sehr viel Arbeit mit den Kindern, wie gesagt, 58 Stunden pro Woche. Uns muss bewusst sein, dass Mütter einen wesentlichen Teil zum Gemeinschaftswohl beisteuern, indem sie Kinder aufziehen. Sie machen das nicht einfach privat, sondern als eine Gemeinschaftsarbeit. Wenn wir keine Kinder mehr haben, stirbt unsere Gesellschaft aus. Die Geburtenrate in den Industrieländern liegt bereits jetzt sehr tief. Der Kinderarzt Remo Largo hat mir erzählt, dass die meisten jungen Eltern sich eigentlich 2 bis 3 Kinder wünschen würden. Aber es geht einfach in unseren Strukturen nicht.
Ein Müttergeld bindet die Frauen doch wieder an den Herd! Müsste es nicht ein Elterngeld sein?
Nein, weil das dann aufs Gleiche hinausläuft wie bei den Kinderzulagen: Die erhält ja paradoxerweise nicht die Person, die die Kinder mehrheitlich betreut, sondern diejenige, die mehr verdient, und das ist ja wiederum in den meisten Fällen der Mann. In der kapitalistischen Logik muss die Mutter für ihre Entbehrungen, ihre körperlichen Strapazen und ihre Arbeit bezahlt werden. Im Kapitalismus ist es so: Was nichts kostet, ist nichts wert. Ich will deshalb, dass die Frauen das Geld bekommen. Zudem würde ein Müttergeld nicht nur Mütter, sondern auch Väter vom Erwerbszwang, der mittlerweile in unserer Leistungsgesellschaft herrscht, befreien. Männer könnten selbstbewusster fordern, ihr Arbeitspensum zu reduzieren, weil sie nicht mehr ausschliesslich dem Chef ausgeliefert wären. Frauen könnten ihren Beruf so ausüben, wie sie es für richtig erachten – vor allem aber müssten sie nicht mehr nach 14 Wochen Mutterschaftsurlaub ihr Kind in eine Kita eingewöhnen und im Büro erscheinen, so als ob nichts passiert wäre. Sowohl für Frauen wie auch für Männer bestünde die Möglichkeit, ihren Beruf auf selbständige Weise auszuüben. Mit dem Geld wäre ein Grossteil der anfallenden Kosten (Mieten, Krankenkassenprämien, Steuern und Kita-Auslagen) bezahlt, so dass der wirtschaftliche Druck nicht mehr Überhand nähme. Familien verfügten plötzlich über das, was ihnen am meisten fehlt: Zeit und Geld.

«Auch Väter stehen heute unter Druck. Ihre Löhne sind keine Ernährerlöhne mehr, und der neue Begriff des ‹modernen Vaters› ist nichts anderes, als das gleiche Konstrukt der Vereinbarkeit auf die Männer übertragen.»
Wie kommen wir dahin? Mütter sind eine sehr heterogene Gruppe, und vermutlich hinterfragen auch die wenigsten das heutige System. Wie lassen sich die Mütterinteressen besser organisieren?
Der Frauenstreik ist ein hoffnungsvolles Signal. Wir Frauen müssen uns zusammenschliessen und uns solidarisieren, wie es auch die EKdM – die Eidgenössische Kommission dini Mueter – mit ihren Aktionen macht. Wir müssen auf die Strasse. Auch Frauen wie Tamara Funiciello machen es vor. Sie ist 30 und kinderlos – und setzt sich mit einer unglaublichen Kraft für Mütteranliegen ein. Mit 30 war ich aus heutiger Sicht total neoliberal geprägt und konsumorientiert. Wenn ich Frauen wie Tamara sehe, macht mir das Hoffnung, dass mehr und mehr Menschen erkennen, dass unser System nicht gottgegeben ist.
Zum Schluss: Sie haben drei Kinder. Wie machen Sie es?
Es geht nur, weil ich meinen Job aufgegeben habe und heute als freischaffende Autorin tätig bin.
Warum hat Ihr Mann nicht gekündigt?
Er hat nach dem ersten Kind das Pensum reduziert. Aber im Gegensatz zu mir machte er auch nach dem Elternwerden Karriereschritt um Karriereschritt. Spätestens beim dritten Kind war klar, dass wir mehr Zeit brauchen für die Kinderbetreuung und Hausarbeit. Da war die Schere zwischen seiner und meiner beruflichen Laufbahn aber bereits dermassen weit geöffnet, dass sich die Frage gar nicht mehr stellte, wer diese Zeit einsetzen soll.
«Schluss mit Gratis! Frauen zwischen Lohn und Arbeit», Limmat-Verlag, Zürich 2019
«Müde Mütter – fitte Väter. Warum Frauen immer mehr arbeiten und es trotzdem nirgendwohin bringen», Limmat-Verlag, Zürich 2015
Ulrike Meutzner lebt und arbeitet in Bern.
ulrikemeutzner-photography.com
Unter dem Namen Other Days Photography porträtiert sie Familien.



